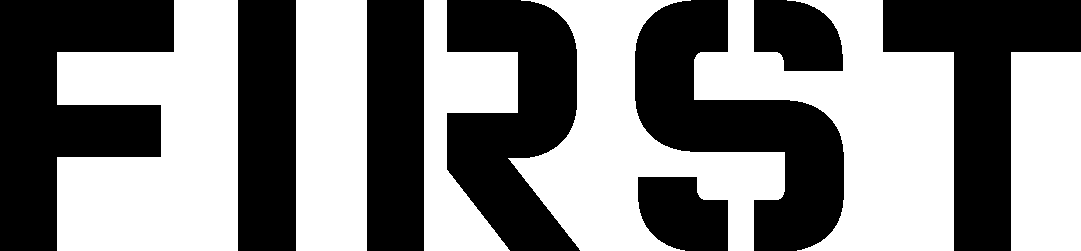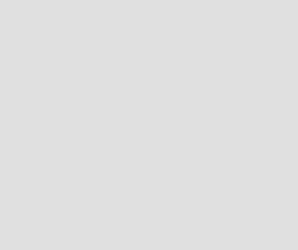03/2014 Freiräume
Stil.Form
Wohnen über den Weichenstellern
Der moderne Holzbau kann bei Aufstockungen im Bestand vielfältige Ansprüche erfüllen. Eine alte Bahngüterhalle in Zürich Giesshübel dient heute als Büroraum und trägt zugleich 24 neue Wohnungen. Der «Pile-up» überzeugt durch seine vielfältige Nutzung und eine unschlagbare ÖV-Anbindung.
Ein gelungenes Beispiel für die urbane Nachverdichtung steht seit letztem Sommer in Wiedikon. Unmittelbar beim Bahnhof Zürich Giesshübel erheben sich über dem massiven Sockel eines 1962 erstellten Bahnbetriebsgebäudes vier elegante Geschosse. Die einheitlich verputzte Fassade lässt einen Massivbau vermuten. «Kaum jemand ahnt beim ersten Blick, dass wir mit Holz gebaut haben. Anders wäre es aber gar nicht gegangen», sagt Armin Hehli, Direktor der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) und Projektverantwortlicher auf Bauherrenseite. Das bestätigt Yves Schihin, Partner bei Burkhalter Sumi Architekten: «Bei Massivbauweise hätten wir wegen der 300 Prozent höheren Dichte von Beton nur ein Geschoss aufstocken können. Und mit Stahlbau wären die beidseitig auskragenden Balkone schwierig zu realisieren gewesen.» Das geringe Gewicht, die effiziente Vorfabrikation und die kurze Bauzeit, die frühzeitig Mieteinnahmen erlaubt, waren weitere wichtige Argumente für den Holzbau. Seit letztem Frühling sind die 24 Wohnungen vermietet, die Nachfrage ist gross. «Näher an der Haltestelle kann man kaum wohnen, und in nur drei Minuten ist man am Zürcher Hauptbahnhof», hält Armin Hehli fest.
Gehirn im Keller
Im Erdgeschoss und im ersten Geschoss befinden sich heute die früher dezentralen Büros der SZU und die Leitstelle. Die Mieter besitzen eigene Zugänge zum Gebäude, was ein friedliches Nebeneinander ermöglicht. Was heute als ideale Lösung erscheint, bereitete den Beteiligten jedoch einiges Kopfzerbrechen. Eine Umnutzung des Giesshübel-Areals, das durch den abnehmenden Bahngüterverkehr zunehmend brach lag, wurde von der SZU bereits in den 1990er-Jahren geprüft. Erst der zweite Projektwettbewerb im Jahr 2004 brachte dann überzeugende Lösungen hervor. Die zentrale Knacknuss war der Sockelbau der Güterhalle. Seit Jahrzehnten ist hier die gesamte Bahntechnik der SZU untergebracht. Hinter einer unscheinbaren Tür klacken Relais und blinken Lämpchen, ein gut fünfzigjähriges Stellwerkpult ist an die Wand geschraubt. Erst in einigen Jahren muss die robuste Stellwerktechnik mit neuen Komponenten ersetzt werden. «Diese Anlagen zu verlegen, wäre viel zu aufwendig und zudem viel zu teuer gewesen. Deshalb verlangten wir, dass der Sockelbau erhalten bleibt», sagt Hehli.
Mit der Holzbauweise fanden Burkhalter Sumi Architekten eine praktikable Lösung für die Aufstockung. Doch zuerst musste die bestehende Aufstockung, ein zweigeschossiger Stahlbau von 1981, weichen. Mit Spezialwerkzeug und viel Feingefühl wurde der Rückbau vorgenommen, ein Sensor im Keller registrierte jede Erschütterung. Denn ein Ausfall der empfindlichen Technik hätte den Bahnverkehr auf dem SZU-Netz lahmgelegt. «Es gab während der ganzen Bauzeit keinen einzigen Vorfall, wir sind sehr zufrieden», hält Hehli fest.
Raffinierte Hybridlösung
Die viergeschossige Aufstockung wurde mit Wandelementen im Holzrahmenbau und Hohlkastendecken ausgeführt. Fünf Holzbauer montierten die insgesamt 690 Elemente in nur 30 Tagen – wenig mehr als eine Woche pro Stockwerk. «Die Bodenelemente waren relativ einfach herzustellen, die Wandelemente wegen der Türöffnungen und des Lastabtrags der vier Stockwerke dagegen sehr anspruchsvoll», sagt Roman Niederberger, verantwortlicher Projektleiter bei der Hector Egger Holzbau AG. Mit einer Holz-Stahl-Hybridbauweise konnten die statischen Anforderungen dennoch erfüllt werden. In manchen Elementen sind bis zu 40 Millimeter starke Stahlbolzen verbaut. Zahlreiche Anschlüsse wurden mit traditionellen Schwalbenschwänzen gelöst. «Diese Verbindungen sind sehr stabil, bei Handarbeit aber fast nicht zu bezahlen. Mit unserer Abbundmaschine konnten wir sie in kürzester Zeit in hoher Qualität herstellen», freut sich Niederberger. Oben und unten aufgeleimte Dreischichtplatten stabilisieren die Verbindungen.
Die Fassadenelemente sind auf der Innenseite mit einer Dreischichtplatte, auf der Aussenseite mit Gipsfaserplatten und Windpapier beplankt. Der einheitliche Verputz für die beiden Betongeschosse und den hölzernen Aufbau suggeriert eine einheitliche Oberfläche. Auf den ersten Blick erscheint der «Pile-up» eher als Massiv- denn als Holzbau. Nur die sichtbaren Bohlen der Balkondecken durchbrechen diese Illusion. Im Kontext der Arealüberbauung wirkt das Gebäude dennoch passend. Das zeigt der Blick auf die beiden benachbarten Bauten, die ebenfalls von Burkhalter Sumi entworfen wurden. Ein doppelt geknicktes Wohngebäude, der «Mäander», sowie ein achtgeschossiges Apartmenthaus verwandeln das Giesshübel-Areal in einen Ort hoher Dichte. Wie eine letzte Erinnerung an beschauliche Zeiten wirken das alte Stellwerk auf der anderen Seite der Geleise und die letzten Arbeiterhäuschen aus unverputztem Backstein.
Stahlharte Grundlage
Der Lastabtrag erfolgt auf die Längswände des Sockelbaus. Dazu wurden Stahlträger im Abstand von rund fünf Metern auf bestehende Lastabnahmepunkte aufgelegt. «Die Träger haben wir in der Mitte auf die bestehende Stahlbetondecke abgespannt, damit sie gerade liegen», erläutert Roman Niederberger. Die Elementanschlüsse an die stählernen Hauptträger lösten die Holzbauer teilweise mit Stahldübeln und Schlitzeisen. Neben Holz und Stahl umfasst der «Pile-up» als echter Hybridbau auch Treppenhäuser und Aufzugstürme in Beton. So werden gleichzeitig die Brandschutzauflagen eingehalten und die Statik wird verbessert. «Die Kerne dienen zur Aussteifung und Abnahme der Windlasten, zudem erhöhen sie die Erdbebensicherheit», führt Yves Schihin aus.
Aus Sicht der SZU war die Arealumnutzung ein aufwendiges, aber lohnendes Projekt. «Als Bahngesellschaft sind wir vor allem mit Tief- und Gleisbau vertraut. Der Hochbau war für uns ein neues Terrain. Das war eine ähnlich grosse Herausforderung wie die Beschaffung von neuem Rollmaterial», sagt Armin Hehli. Dank einer Bauherrenbegleitung, einheitlichen Projektleitern und nicht zuletzt dem fachlichen Support von Statikern und Ingenieuren aus dem Verwaltungsrat der SZU habe man das Projekt aber gut meistern können. «Wir haben die Liegenschaftsverwaltung ausgelagert und vermieten zu marktüblichen Preisen. Das ist ein ungewohnter, aber sehr willkommener Beitrag zur Defizitdeckung des öffentlichen Verkehrs», sagt Hehli.
Das Bauvolumen des «Pile-up» betrug 10,5 Millionen Franken. Finanziert wurde es durch den Verkauf der Grundstücke für die beiden anderen Gebäude. Die rund zehn Prozent höheren Baukosten der Holzbaulösung habe man rasch egalisieren können: Wer schnell baut, kann auch schnell vermieten. Ein willkommener Nebeneffekt des Projekts sind die zentralisierten und grosszügigen Büroräume für die Mitarbeitenden der SZU. Bei der Wärme- und Elektrizitätsversorgung bemühte man sich, im Rahmen des Möglichen der Vorbildrolle gerecht zu werden. Die primäre Wärmequelle ist die Gasheizung im Nachbargebäude. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach liefert zusätzlichen Strom und die Bahntechnik im Keller Abwärme, mit der im Winter die Büroluft vorgewärmt wird.
Grosse Marktchancen
Für die Hector Egger Holzbau AG war das Projekt die erste grössere Aufstockung im Raum Zürich, wie Roman Niederberger sagt: «Wir denken, dass dieses Volumen in Zukunft noch anziehen wird. Das geringe Gewicht der Aufbauten ist ein grosser Vorteil für Aufstockungen.» Diese Einschätzung bestätigt Yves Schihin: «Die Innenverdichtung in Städten ist sehr sinnvoll und wird von Behörden und Investoren gefördert. Der Holzbau hat nach unserer Meinung ein sehr grosses Potenzial, weil die Materialeigenschaften ideal sind.» Aus Architektensicht sei auch der Beitrag des Holzbaus zum «reversiblen Städtebau» zu beachten, meint Schihin. Falls die Städte dereinst wieder schrumpfen sollten, könne man die Aufstockungen sehr einfach rückbauen und das Holz weiterverwenden.
Ansichten-Fronten.pdf
Detailbuch-Holzbau B.pdf
Massiv an Holz.pdf
Querschnitt.pdf
Situation.pdf
Das Projekt – die Fakten und Zahlen
Als Teil der Arealüberbauung Giesshübel wurde der «Pile-up» von 2011 bis 2013 realisiert. Im Sockelbau sind Bahntechnik, Leitstelle und 35 Arbeitsplätze der SZU untergebracht, im viergeschossigen Holzbau 24 Lofts und Mietwohnungen mit
2,5 bis 4,5 Zimmern.
Bauherr: Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn SZU AG, Zürich
Architekt: Burkhalter Sumi Architekten, Zürich
Fachingenieur Statik/Brandschutz: Makiol+Wiederkehr AG, Beinwil am See
Holzbau: Hector Egger Holzbau AG, Langenthal
Totalunternehmer: Unirenova AG, Zürich