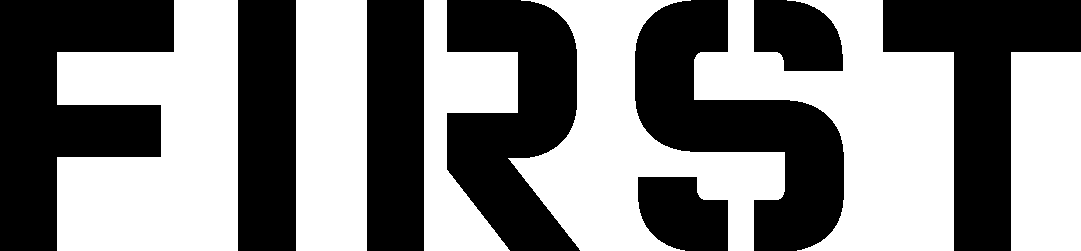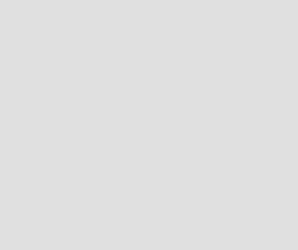03/2014 Freiräume
Lebens.raum
Ämmitaler Ruschtig
Eher Spaziergang als Wanderung: Auf dem Emmentaler Holzbrückenweg entdeckt man zwischen schattigen Wäldern und lieblichen Flusslandschaften die Brückenbaukunst alter und neuer Zeiten.
Das Emmental lockt Wanderer mit sanften Hügellandschaften und den berühmten Meringues. Seit Kurzem gibt es im «Högerland» eine neue Attraktion: Der gut 20 Kilometer lange Holzbrücken-Themenweg verbindet 18 Brücken in sechs Gemeinden. So etwa die 1988 erbaute Bubeneibrücke über die Emme. Sie gehört zu den frühen Beispielen für die Renaissance des Schweizer Holzbrückenbaus. Mit ihrer Tragkraft von 40 Tonnen und der Spannweite von 25 Metern setzte die Brücke bei ihrer Eröffnung einen wichtigen Markstein. Nur vier Jahre nach dem Bau der neuen Dorfbrücke in Eggiwil konnten mit dem Bauwerk wichtige Erfahrungswerte zur Fahrbahnkonstruktion und zur Brettschichtverleimung bestätigt und vertieft werden.
Die Querträger der Bubeneibrücke sind an den brettschichtverleimten Zwillingsbogen mit 90 Millimeter starken Rundeisen aufgehängt. Das filigrane Erscheinungsbild täuscht über das beträchtliche Eigengewicht von 200 Tonnen hinweg. Auch wenn sie als Holzbrücke wahrgenommen wird, sind in der eleganten Konstruktion dennoch 26 Tonnen Stahl verbaut. Mehr als 330 Kubikmeter Schweizer Konstruktionsholz stecken in diesem Statement einheimischer Brückenbaukunst.
Die Geschichte dahinter
Die moderne Bubeneibrücke und ihre behäbigen Schwestern aus der Familie der «Hüslibrücken» lassen vergessen, wie mühselig das Reisen in vergangenen Tagen war. Lange Zeit konnte die Emme nur auf wackligen Stegen überschritten werden. Erst 1550 entstand bei Schüpbach die erste Brücke über den Fluss. Mit einem Brückenzoll und Beiträgen der Gemeinden von Wohlen bis Schangnau wurde das Bauwerk eher notdürftig finanziert. Fast 300 Jahre sollte die Jochbrücke Bestand haben. Dann kam der August 1837. Starke Gewitter in der ersten Monatshälfte führten zu einer fast vollständigen Wassersättigung der Böden. Am 13. August folgte das Hochwasser, die berühmte «Emmenschlange». Ein zeitgenössischer Bericht schildert diese wie folgt: «Ich ging der Emme nach, sah, wie furchtbar sie wider Schüpbach anrannte und wieder in der dortigen Beugung die Säge teilweise zerstörte, die Brücke zerriss, der Zollbrücke zustürzte, um dort das gestern angefangene Werk zu vollenden. Sie kam gerade noch zu rechter Zeit, um den dortigen Arbeitern die Mühe des Abbrechens zu ersparen. Mit gewaltigen Armen riss sie die Brücke weg, trug sie spielend fort.»
Es ist nicht die einzige solche Szene in Jeremias Gotthelfs «Wassernot im Emmental». Über weite Strecken liest sich dieser Text wie eine Reportage aus einem Katastrophengebiet. Gotthelf, damals Pfarrer in Lützelflüh BE, hatte eigene Erfahrungen wie auch zahlreiche Augenzeugenberichte verwertet. Auf heutige Leser mögen Gotthelfs predigthafte Einschübe etwas ermüdend wirken. Doch die Fakten in seinem Bericht sind offenbar verlässlich. Vor einigen Jahren rekonstruierten Hydrologen der Universität Bern das Hochwasser im Emmental anhand eines hydrologischen Modells. Das Fazit: In der bernischen Dichtung steckt sehr viel Wahrheit. Den maximalen Abflusswert des Rötenbaches bei Eggiwil setzten die Forscher auf rund 300 Kubikmeter pro Sekunde fest – rund 200-mal so viel wie der mittlere Abfluss dieses Baches in einem Sommermonat.
Verheerung und Neuanfang
Neben der Schüpbachbrücke zerstörte das Hochwasser von 1837 auch die Rüegsau- und die Zollbrücke über die Emme. Die Berner Regierung beschloss, diese drei Brücken auf eigene Rechnung neu aufbauen zu lassen, und zwar erneut aus Holz. In einer zeitgenössischen Stellungnahme der Berner Baudirektion heisst es: «Vor allem glauben wir mit Sicherheit die Idee von steinernen Brücken über die Emme entfernen zu sollen, da sowohl die Ufer sich nicht dazu eignen und auch das Material nicht vorrätig ist und im Emmental überhaupt die Bauten in Holz vorherrschen.» Das Material war damit gesetzt, die Brückenform jedoch sollte Neuem weichen. Anstelle der früheren Jochbrücken entschied man sich für Bogenbrücken. Bei den stützenfreien Bauwerken waren die verhängnisvollen Geschiebestauungen kaum noch zu befürchten, zudem erleichterten sie das Flössen von Rundhölzern auf der Emme.
Nicht nur für die Brücken über Emme und Ilfis mussten neue Lösungen gefunden werden, sondern auch für die Zuflüsse. So zerstörte 1891 ein Hochwasser alle Brücken über die Trub. Eine der Nachfolgebauten aus demselben Jahr ist die Ölibrücke in Trubschachen. Ihre Spannweite beträgt 24 Meter, die Gesamtlänge knapp 29 Meter. Die Konstruktion ist mit Ständerfachwerken und Druckstreben aufgebaut. Das dreifache Hängewerk wird von einem weit auskragenden Satteldach überwölbt. Die Querträger wurden direkt auf die Streckbalken verlegt und die Quergebinde mit Diagonalen versteift. Holzbauer sollten sich einige Minuten Zeit für einen Blick unter die Brücke nehmen. Denn die hölzerne Fahrbahnplatte ist mittels eingeleimter Zugstangen quer vorgespannt. So werden sämtliche Quer- und Windkräfte auf die QS-Platte abgegeben. Messversuche der ETH Zürich haben gezeigt, dass die Konstruktion äusserst robust ist.
Die Alten und die Neue
Von den Schrecken vergangener Zeiten ist auf dem Holzbrückenweg nur wenig zu spüren. Der Initiant Hanspeter Buholzer aus Langnau ist seit Jahren von den mächtigen Bauwerken fasziniert. Im Weg, der das Bekannte in ein neues Licht stellt, sieht er auch eine gewisse Weckfunktion: «Vielen Einheimischen wurde erst jetzt bewusst, wie viele dieser schönen Brücken in unserer Region stehen – immerhin jede neunte der rund 300 Schweizer Holzbrücken.» Während die klassischen Emmentaler Wanderrouten «Högerli uf, Högerli ab» führten und vor allem für Menschen mit einer robusten Kondition gedacht seien, ergänze die neue Route das Wegnetz um eine schattige, ebene Variante: «Auf dem Holzbrückenweg kann man es gemütlich nehmen.»
Die geruhsame Wanderung lässt Zeit für vergleichende Beobachtungen. Denn neben dem Alten schätzt man im Emmental auch das Neue. Als Ersatz für eine 1903 erbaute Fachwerkbrücke erstellt, ist die Anfang 2007 fertiggestellte Obermattbrücke über die Ilfis ein echter Hingucker. Die Trogbrücke besitzt im Gegensatz zu den klassischen «Hüslibrücken» kein Dach – bei der zweispurigen Fahrbahnplatte wäre dieses auch eher klobig ausgefallen. Doch zu Beginn waren die Einheimischen wenig begeistert, wie sich Walter Hertig, Geschäftsführer der Walter Hertig Holzbau AG, erinnert: «Am Anfang hörten wir nur: ‹Geits no, ä Brügg ohni Dach, das häbt doch nid!›» Die Dachhaut ist bei der Obermattbrücke jedoch gleichsam um das Tragwerk geschmiegt: Die Primärträger aus dreifach verleimtem Brettschichtholz wurden mit hinterlüfteten Lamellen aus druckimprägnierter Emmentaler Weisstanne verkleidet. Eine Lösung, die sich bis heute bewährt.
Nicht nur architektonisch, auch technisch setzt die Obermattbrücke einen Akzent. Als eine der wenigen, wenn nicht als einzige Schweizer Holzbrücke besitzt sie eine Hebevorrichtung. Vier hydraulische Pressen mit einer Hubkraft von jeweils 50 Tonnen können den Oberbau in gut fünf Minuten um 70 Zentimeter anheben. So wird das Bauwerk vor Schäden bewahrt. Zudem vermeidet man eine Verblockung des Durchflussprofils und damit lokale Überflutungen. Ihren ersten Praxistest bestand die Obermattbrücke beim Hochwasser im August 2007. Seither wird die Funktion der Hubeinrichtung jährlich kontrolliert. Für Walter Hertig ist das Bauwerk nach wie vor ein Leuchtturm des Holzbrückenbaus. Und auch die Einheimischen haben ihre Meinung geändert, wie er sagt: «Das fehlende Dach stört niemanden mehr. Stattdessen heisst es ganz stolz: ‹Ja, und üsi Brügg cha me de ou no lüpfe.›»
Das Emmental neu erleben
Für Christian Billau, Leiter Emmental Tourismus, ist der neue Holzbrückenweg eine willkommene Erweiterung des touristischen Potenzials: «Unsere Landschaft ist sehr schön, jedoch gibt es Regionen in Europa, die ähnlich aussehen. Was uns von diesen unterscheidet, sind die Bauernhäuser und die Holzbrücken.» Als Alleinstellungsmerkmal verdienten diese Bauwerke auch mehr Aufmerksamkeit. Es gehe nicht etwa um eine Image-Erweiterung, sondern um ein neues Angebot für eine ausgewiesene Nachfrage, meint Billau: «Seit Jahren gibt es den Eggiwiler Haus- und Holzbrückenweg. Der neue Weg erweitert dieses Thema.» Nur einen offenen Wunsch hat der oberste Touristiker: «Es wäre schön, wenn die Initianten in Zukunft auch Fachführungen anbieten würden. Ein Themenweg ist gut, ein buchbares Angebot ist noch besser.» An Objekten fehlt es nicht. Die 1996 fertiggestellte Buchschachenbrücke in Eggiwil ist eine klassische Bogenträgerbrücke. Für Bogen und Hängepfosten kam verleimtes Brettschichtholz zum Einsatz. Die Dachkonstruktion ist dagegen aus Kanthölzern aufgebaut, die Fahrbahn ruht auf Querträgern aus Stahl. Mit 10 Tonnen Tragkraft gehört die Brücke zu den kleineren Kalibern – ein Wort, das hier durchaus passt. Denn das Bauwerk erschliesst den 300-Meter-Schiessstand im Buchschachen bei Eggiwil. Solche Details stören nicht: Schützenlärm und Alltagshektik scheinen auf dem Themenweg weit weg. Wer durch die schattigen Wälder von Brücke zu Brücke geht und sich auf die Meringues freut, ist auf wohltuende Weise «ab vom Schuss».
Buchschachenbrücke – die Spitzbübische (17)
Standort: Emme, Gemeinde Eggiwil
Baujahr: 1996
Konstruktion: Bogenträgerbrücke
Material: Brettschichtholz Tanne, Kantholz Fichte/Tanne
Tragfähigkeit: 10 Tonnen
Besonderes: Auffallend sind die beiden
geschwungenen Eingangsportale aus Brettschichtholz. Die Spitzbogen bringen einen Hauch von Gotik ins obere Emmental.
Bubeneibrücke – die Elegante (12)
Standort: Emme, Gemeinde Eggiwil
Baujahr: 1988
Konstruktion: Bogenbrücke
Material: Fichte (Bogen), Weisstanne
(Querträger, Fahrbahn), Buche (Fahrbahn)
Tragfähigkeit: 40 Tonnen
Besonderes: Das Tragsystem ist auf zukünftige Lasterhöhungen ausgelegt.
Obermattbrücke – die Steigfähige (9)
Standort: Ilfis, Gemeinde Lauperswil
Baujahr: 2007
Konstruktion: Holztrogbrücke mit Betonwiderlagern
Material: Brettschichtholz (Träger), Lärchenholzlamellen (Verkleidung), Furnierschichtholzplatten (Querträger)
Tragfähigkeit: 40 Tonnen
Besonderes: Anhebung der Brücke mit vier hydraulischen 50-Tonnen-Pressen.
Ölibrücke – die Raffinierte (3)
Standort: Trub, Gemeinde Trubschachen
Baujahr: 1891
Konstruktion: dreifaches Hängewerk mit Satteldach
Tragfähigkeit: 3,5 Tonnen
Besonderes: Charakteristisch für die Zeit um die Jahrhundertwende sind die von Hand behauenen Natursteinquader und die Schnitzereien im Schweizer Holzstil am Eingangsportal.